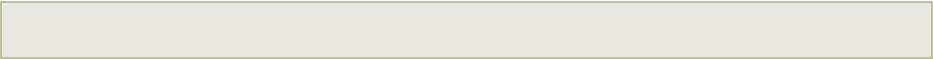












01.12.2016 Fünf Thesen zum Thema „Ein Jahr nach dem
Krankenhausstrukturgesetz – wie geht es mit der Qualität weiter?“
Start der Podiumsdiskussion zur Eröffnung des 10. Nationalen
Qualitätskongresses
1.-2.12.2016 10. Nationaler Qualitätskongress - ein kleines Jubiläum für den
mittlerweile größten Kongress zum Thema Qualität und Sicherheit, den wir in
Deutschland haben. Der Kongress startete mit einer Podiumsdiskussion, die sich
der wirklich drängenden Frage widmete: „Ein Jahr nach dem
Krankenhausstrukturgesetz – wie geht es mit der Qualität weiter?“ Die fünf Thesen zum Auftakt der Podiumsdiskussion hier in
der schriftlichen Fassung:
1. These: Das KHSG stellt im Krankenhausbereich die wichtigste gesetzliche Neuerung des SGB V seit der
DRG-Einführung dar, verharrt aber in der sektoralen Perspektive.
Das KHSG hat eine deutliche Systematisierung und eine deutliche Bedeutungszunahme des Qualitätsgedankens
im SGB V mit sich gebracht, so dass mit Recht vom wichtigsten Gesetzgebungsverfahren im Krankenhausbereich
seit der DRG-Einführung gesprochen wird. Qualität und Sicherheit der Versorgung haben sich hiermit als vierte Agenda für die
weitere Entwicklung des Gesundheitswesens etabliert (neben Wettbewerb, Patientenorientierung und Legitimierung durch
wissenschaftliche Evidenz).
Eine vergleichbare Anstrengung zur Systematisierung eines größeren Themenbereichs der Gesundheitspolitik hat es in den
letzten Jahren nur im Rahmen des Patientenrechtegesetzes von 2013 (Etablierung des Behandlungsvertrages als eigene
Vertragsform nach §630a ff BGB), der ambulanten Selektivversorgung durch Neufassung des §140a SGB V im
Versorgungsstärkungsgesetz im Jahr 2015 und evtl. in der Pflegereform gegeben.
Die entsprechenden Vorschriften sind grob in vier Abschnitte zu unterteilen:
1. Verpflichtung zur Qualitätssicherung in den §§ 135a-c, hierin enthalten z.B. Regelungen zur Integration des
Beschwerdemanagements (§135a Abs. 2) und zur haftungsrechtlichen Bewertung von CIRS-Systemen (§135a Abs. 3), zur
Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen mit Stichprobenverfahren (§135b Abs. 2) und der Option einer qualitätsorientierten
Vergütung (§135b Abs. 4) sowie zur Deutschen Krankenhausgesellschaft mit Bestimmungen zur Begrenzung der
Mengenausweitung (Regelungen zu Chefarztverträgen, §135b);
2. Rolle des G-BA in der Qualitätssicherung in den §§ 136 bis 136d, hierin enthalten dessen allgemeine
Richtlinienkompetenz (§136), ausgewählte Problembereiche (§136a) mit Regelungen zur Hygiene, Psychiatrie,
Patientensicherheit und zahnärztlichen Versorgung, dann der zentrale §136b mit den Regelungen zum Krankenhausbereich
mit den Schwerpunkten Mindestmengen (Abs. 3-5), Qualitätsbericht (Abs. 6 und 7), Qualitätsverträgen nach §110a (Abs. 8)
und qualitätsorientierte Vergütung (Abs. 9), der aktuelle §136c mit den Regelungen zur qualitätsorientierten
Krankenhausplanung sowie der §136d mit der Berichtspflicht des G-BA zum Stand und zur Weiterentwicklung der
Qualitätssicherung;
3. Aufsichtsfunktion des G-BA in §137 mit den Regelungen bei Nichteinhaltung der Qualitätsanforderungen (Abs. 1), zur
Dokumentationsquote (Abs. 2) und zur Kontrollfunktion des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (Abs. 3); und
4. die Regelungen zum IQTiG in §137a und b, die weitestgehend auf das Finanzstruktur- und
Qualitätsweiterentwicklungsgesetz von 2014 zurückgehen und hier nur um den Abs. 11 ergänzt werden, der die
Datenweitergabe an die Landesbehörden zu Zwecken der qualitätsorientierten Krankenhausplanung regelt.*
In der politischen Einschätzung ist nicht zu übersehen, dass solche weitgehende Änderungen, die sich tief in den Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung erstrecken (z.B. Krankenhausplanung), nur in der derzeitigen politischen Konstellation in
Bundestag und Bundesrat zustandekommen können. Die kritische Betrachtung zeigt aber auch, wie sehr die Gesetzgebung
immer noch ihren historischen Wurzeln nachhängt, die im Zusammenhang mit der Einführung der Fallpauschalen und
Sonderentgelte im Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 den Gedanken der Qualitätsdarlegung (Qualitätssicherung) im
Krankenhaus in den Mittelpunkt stellen. Zwei Punkte sind hier herauszuheben:
1. Es besteht ein deutliches Übergewicht der Regelungen zum Krankenhausbereich (§136b), die weitaus breiter und
tiefgehender sind als die Regelungen im ambulanten Bereich (§135b), in der zahnärztlichen Versorgung (136a Abs. 4) und in
der rehabilitativen Versorgung (§137d).
2. Es fehlt leider eine Befassung mit der Qualität der regionalen Versorgung, auch und gerade unter Beachtung der
entstehenden integrierten Versorgungsstrukturen mit Selektivvertragscharakter (s. §140a). Längst ist die sektorale und
institutionelle Betrachtung des Themas Qualität Vergangenheit, es geht heute zusätzlich und vermehrt um die Steuerung durch
Qualität auf Systemebene (Quality Improvement resp. Qualitätsverbesserung auf Systemebene). Da die Ausbildung integrierter
Versorgungsstrukturen in einem weitgehend ungeordneten Prozess bereits im vollen Gange ist, muss politisch der Gefahr
entgegengewirkt werden, dass Instrumente zur Beschreibung von Qualität dieser regionalen Strukturen nicht rechtzeitig zur
Verfügung stehen.
2. These: Die Regelungen zur qualitätsorientierten Krankenhausplanung ergänzen den Begriff der
Bedarfsgerechtigkeit durch Qualität und Patientengerechtigkeit (§1 Abs. 1 KHG), was sinnvoll und zeitgemäß
erscheint; trotzdem besteht die Gefahr der Fehlsteuerung durch die Verwendung inadäquater Indikatoren,
durch einen paradoxen Investitionsanreiz bei Verwendung von Strukturindikatoren und durch die Verstärkung
der Tendenz zur sektoralen (statt regionalen) Optimierung.
In der qualitätsorientierten Krankenhausplanung nach §136c SGB wird Qualität neben der Patientengerechtigkeit
(s. KHG §1 Abs. 1) dem Bedarf an die Seite gestellt, wodurch die Krankenhausplanung sehr viel adäquater
gestaltet werden kann. Die überholte Nennung der „Vielfalt der Krankenhausträger“ als Ziel der Krankenhausversorgung wird
relativiert (§8 Abs. 2 Satz 2 KHG). Es besteht jedoch die Gefahr einer eklatanten Fehlsteuerung, wenn
1. inadäquate Indikatoren verwendet werden, die
1.1. zu anderen Zwecken entwickelt wurden (z.B. Indikatoren zur Qualitätssicherung in der operativen Akutmedizin bei
Einführung der Fallpauschalen Mitte der 90er Jahre),
1.2. die zu Steuerungszwecken nicht geeignet sind (z.B. Indikatoren zu Leistungsbereichen, die hinsichtlich des
Handlungsbedarfs der heutigen Krankenhausplanung keine zentrale Rolle spielen (z.B. Herzchirurgie)), oder
1.3. die zu Interferenzen mit anderen Entwicklungen führen (z.B. wenn Zentralisierungsbestrebungen schon mit anderen
Mitteln umgesetzt werden (z.B. Neonatologie));
2. Strukturindikatoren verwendet werden, die zur Zementierung der bestehenden Strukturen führen (Investitionsanreiz statt
Restrukturierungsanreiz), und wenn
3. die Qualitätsorientierung der Krankenhausplanung zu einer Verstärkung der Sektorierung statt zu einer regionalen
Versorgungsplanung führt.
Das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung (DNVF) hat entsprechend seiner Beauftragung nach §137a Abs. 7 Nr. 8 SGB V
anlässlich des Vorberichts des IQTiG zur qualitätsorientierten Krankenhausplanung ausführlich Stellung genommen
(download). Entscheidend in der Argumentation war dabei die Ansicht, dass Patienten- und Gesichtspunkte der regionalen
Versorgung zwingend Beachtung finden müssen, weiterhin müssen die verwendeten Indikatoren (auch wenn sie gemäß des
Auftrages des G-BA an das IQTiG aus dem vorhanden Bestand ausgewählt werden sollen) für die Zielgruppe von
Krankenhäusern, bei denen der größte Bedarf an planerischem Eingreifen besteht (die kleinen bzw. mittelgroßen Häuser in
Ballungsgebieten), relevant sein. Es bieten sich hier in erster Linie Composite-Indikatoren aus dem Bereich der
Patientensicherheit und Indikatoren zu Krankheitsbildern an, die in diesen Krankenhäusern häufig anzutreffen sind (z.B.
ambulant erworbene Pneumonie).
3. These: Pay for Performance (P4P) bietet die Chance, das Spektrum der herrschenden Vergütungsanreize
(z.B. Mengenorientierung) zu ergänzen, aber auch hier besteht die Gefahr von Fehlanreizen durch technische
Fehler bei der Einführung, durch „abgenutzte“ Indikatoren (sog. dual use) und vor allem durch eine fehlende
Zielorientierung.
Die qualitätsorientierte Vergütung (P4P) ergänzt entsprechend weit verbreiterter internationaler Vorbilder die
Vergütung nach Leistungsmenge durch die Vergütung nach Qualitätsaspekten. Ökonomisch entspricht dies einer
Ergängzung der DRG-Systematik durch qualitätshomogene Gruppen, die nach Qualitätsgesichtspunkten miteinander
vergleichbar sind. Bei adäquater und zielorientierter Verwendung können P4P-Programme zu einer Verbesserung der
Versorgung auf Systemebene führen, insbesondere wenn sie zielgerichtet zur Unterstützung von dringlichen Struktur- und
Prozessveränderungen eingesetzt werden (z.B. Verbesserung der Koordination, Verbesserung der Behandlung von
chronischen Mehrfacherkrankungen). Die Regelungen im KHG, im KHEntgG und im SGB V sind außerordentlich umfangreich
und detailliert, der Zeitplan (Umsetzung bis Ende 2017) sehr ambitioniert.
Diese begrüßenswerte Entwicklung kann jedoch ebenso zu Fehlsteuerungen führen, wenn
1. in der Einführung technische Fehler gemacht werden (inadäquate Anreize z.B. in der Höhe der Vergütungsbestandteile,
zeitliche Entkopplung etc.),
2. die verwendeten Indikatoren bereits in anderen Programmen (Qualitätsbericht) ausführlich genutzt wurden und durch P4P
kein zusätzlicher Effekt mehr zu erwarten ist ("ceiling" durch sog. dual use), und wenn
3. eine für alle Beteiligten verständliche Zielorientierung fehlt - welches Problem soll eigentlich durch P4P gelöst werden?
Zu weiteren inhaltichen und methodischen Fragen s. Text zu P4P. Die Verwendung von sog. Exzellenz-Indikatoren ist aus
statistisch/epidemiologischen Überlegungen äußerst kritisch zu sehen (hohe Spezifität statt hoher Sensitivität) (s.u.).
4. These: Methodische und technische Probleme in der Umsetzung der Initiativen zur Qualitätsverbesserung
auf Systemebene können den Qualitätsgedanken in akute Gefahr bringen.
Dem begrüßenswerten Ausbau des Qualitätsgedankens i.R. des KHSG steht die Gefahr gegenüber, dass
mittelfristig der Qualitätsgedanke beschädigt und desavouiert wird, wenn eine falsch intendierte oder fachlich
inadäquate Umsetzung zu einem Misslingen der gegenwärtig auf der Agenda stehenden Qualitätsprojekte führt. Gerade eine
technisch inadäquate Einführung von P4P mit seiner Kopplung monetärer Anreize an Qualität bei intrinsisch motivierten
Gesundheitsberufen und Institutionen kann zu einer drastischen Verschlechterung der Akzeptanz des Themas Qualität Anlass
geben.
Als übergeordnetes Problem ist die Methodik der sog. "Qualitätsmessung" zu nennen (vgl. auch hier]). Auf sechs Probleme soll
hier kurz eingegangen werden:
1. Valide Indikatoren statt quantitativer Erhebung: Qualitätsindikatoren sagen Defizite voraus und sind daher Problem-
orientiert einzusetzen. In Deutschland werden jedoch Ereignisse vielfach quantitativ erhoben, ohne dass der Bezug auf
Qualitätsprobleme geklärt ist (klassisches Beispiel Mortalität, ein schlechter Qualitätsindikator, der unabhängig von der
jeweiligen Risikoadjustierung maßgeblich von dritten Faktoren bestimmt wird). Diese zunächst belanglos erscheinende
Unterscheidung ist für die Wirksamkeit von Qualitätsverbesserungsmaßnahmen von nicht zu unterschätzender Bedeutung,
denn die quantitative Erfassung macht eine vorherige Problemanalyse entbehrlich. Außerdem sind die statistischen
Anforderungen unterschiedlich, da sich die Validität von Indikatoren auf eine hohe Sensitivität bezieht (unter Inkaufnahme
geringerer Spezifität), im Gegensatz zu quantitativen Methoden mit gleichrangigen Anforderungen an Sensitivität und Spezifität.
Ein sensitiver Indikator wird folglich immer auch einige solcher Einrichtungen als „auffällig“ identifiziert, die gar kein
Qualitätsproblem haben (sog. „intrinsische Ungerechtigkeit“). Für Ärzte sind Indikatoren oft noch aus einem anderen Grund
schwer verständlich, weil das Indikatorenkonzept ihrem Verständnis klinischer diagnostischer Verfahren (zu denen Indikatoren
nicht gehören) zuwiderläuft, bei denen die falsch-positiven Ergebnisse (Spezifität bzw. PPW) im Vordergrund stehen.
2. Ergebnis-Indikatoren zugunsten valider Prozessindikatoren zurückstellen: Obwohl Ergebnisindikatoren durch den
Anschein gestützt und im SGB V genannt werden, sind sie von einer Reihe maßgeblicher Nachteile begleitet:
- sie betreffen bereits eingetretene Ereignisse, während Prozessindikatoren Ereignisse vorhersagen (bad apple-
Problematik),
- sie müssen im Ggs. zu Prozessindikatoren risikoadjustiert werden,
- im Ggs. zu Prozessindikatoren ist die Verantwortlichkeit oft nicht klar (z.B. nach Entlassung aus der stationären
Behandlung),
- kleine Einrichtungen werden aus statistischen Gründen benachteiligt (höhere Häufigkeit von „Ausreißern“,
Einzelereignisse sind nicht zu neutralisieren),
- wenig motivierend wegen der bad apple-Problematik, während Prozessindikatoren ein präventives Eingreifen möglich
machen, und vor allem
- ist ihnen ein Mengenanreiz immanent, was besonders bei P4P-Programmen eine wichtige Rolle spielt (Attraktion leichter
Fälle bei mengenmäßig "ausbaubaren" Leistungen, die Ergebnisqualität steigt, Risikoadjustierungsmodelle sind leicht zu
beeinflussen).
Bei Prozessindikatoren sind jedoch ebenfalls zwei Aspekte zu berücksichtigen:
- sie sind nicht so stark mit den Ergebnissen korreliert, wie man es gerade bei stark EBM-abgesicherten Parametern
meinen sollte. Es ist zwar durchaus ein (hoch-signifikanter) Effekt von Prozessindikatoren auf Outcomes nachweisbar, wie
man z.B. bei immerhin 3657 Krankenhäusern in den USA anhand der Daten aus dem Hospital Compare Programm
nachweisen konnten (Werner et al. 2006), aber quantitativ enttäuschen die Ergebnisse dennoch. Die zu ihrer Evaluation
verwendeten Studiendesigns, die den komplexen Bedingungen, in denen solche Prozessparamater wirken, nicht gerecht
werden, stehen als Ursache in der Diskussion.
- ganz entgegen dem Augenschein sind insbesondere solche Prozessindikatoren, die nicht durch EBM bzw. Leitlinien
abgesichert sind, bei denen also der Informationsvorsprung der „Experten vor Ort“ noch besteht, besonders wirksam,
während bekannt EBM-abgesicherte Prozessindikatoren z.B. in P4P-Programmen keinen Effekt zeigen. Dieser irritierende
Befund lässt sich aus der Principal Agent Theorie erklären. Bei Indikatoren, bei denen die Informationsasymmetrie
aufgehoben ist, ist eine Einzelfallvergütung sehr viel effektiver.
Diese Gesichtspunkte sollen jedoch nicht davon ablenken, dass die international führenden, umfassenden Projekte zur
Qualitätsverbesserung fast ausnahmslos Prozessindikatoren einsetzen (auch wenn schrittweise sog. Outcome-Indikatoren,
also Prozessindikatoren mit starker Ergebnisrelevanz (z.B. Komplikationsraten) einbezogen werden).
3. Vorsicht mit Strukturindikatoren im Zusammenhang mit der Krankenhausplanung - die bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass Träger von Krankenhäusern eher in Strukturveränderungen investieren als eine Schließung in Betracht zu ziehen. Im
Zusammenhang mit P4P wirken Strukturindikatoren als Investitionsbeihilfen, so dass es mittelfristig noch schwieriger wird, das
Krankenhaus in eine integrierte Versorgungseinheit zu überführen („wir haben doch gerade eben die Intensivstation neu
gebaut“).
4. Routine-Daten sind schlecht geeignet, insbesondere wegen ihres Sensitivitätsproblems, da sie in erster Linie die
Vergütungs-bezogene Dokumentation widerspiegeln. Die Sensitivitäts-Problematik wird durch die jetzt auf Routinedaten
umgestellte Erhebung des Dekubitus unterstrichen (ältere Patienten: Underreporting - keine Vergütungsrelevanz; jüngere
Patienten: sehr hohe Raten - hohe Vergütungsrelevanz). Weitergehend sind jedoch folgende Aspekte zu beachten:
- Routinedaten sind (ebenso wie das DRG-System sui generis) Prozeduren-lastig, sie fördern also die operativ-
akutmedizinische Ausrichtung des Systems,
- sie bilden trotz aller „transsektoralen“ Versuche in erster Linie die sektorale Logik der Vergütungssysteme ab und fördern
nicht die Integration,
- sie verstärken den Mengenanreiz des Systems (statt der Prävention),
- sie präjudizieren den Gebrauch von Ergebnis-Indikatoren (mit wiederum Routinedaten-gestützter Risikoadjustierung),
und
- sie stärken den Anbieterbezug (da diese die Vergütung auslösen) und nicht den Patientenbezug.
Routinedaten behindern also die notwendige Neuausrichtung des System und stabilisieren die derzeitige akutmedizinisch-
prozedurale Ausrichtung. Es gibt jedoch auch Indikatoren, die sehr gut mit Routinedaten zu erheben sind (z.B. Mindestmengen
– aber auch hier: Gefahr der Mengenausweitung).
Mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, dass es seit über vierzig Jahren ein prominentes Beispiel gibt, bei dem man mit klinisch-
epidemiologischen Falldefinitionen zu stabilen, international vergleichbaren Zahlen kommt: die Infektionsepidemiologie mit
ihren Falldefinitionen der Centers of Disease Control (CDC). Die Erarbeitung von klinisch-epidemiologischen Falldefinitionen für
die allgemeine Qualitätsicherung sollte mit hoher Priorität auch außerhalb der Infektionsepidemiologie vorangetrieben werden.
5. Patienten-Reported Outcome Measures müssen in den Vordergrund gerückt werden, dazu gehören alle Dinge, die der
Patient selbst und nur selbst berichten kann (z.B. postoperative Schmerztherapie). Sie betreffen vornehmlich den Bereich der
Prozessindikatoren (Koordination, Information, Kommunikation). Diese "PROMS" stellen einen wichtiger Einstieg in das Thema
unterschiedlicher Qualitätsperspektiven dar und sind international bereits im Zusammenhang mit P4P-Programmen in
Gebrauch. Entsprechende Entwicklungen durch das IQTiG nach den Bestimmungen des §137 sind daher von großer
Wichtigkeit.
6. Vorsicht mit dem Begriff der Exzellenz-Indikatoren (z.B. Eckpunkte-Papier der Bund-Länder-Kommission zur
Krankenhausreform („außerordentlich gute Qualität“)): Abgesehen von der sozialrechtlichen Wertung – im SGB V (z.B. §12)
werden die Beriffe „ausreichend“,, „zweckmäßig“, „wirtschaftlich“ und „notwendig“ verwendet – werden Indikatoren auch
international immer zur Vorhersage negativer Entwicklungen verwendet. Hinzu kommen statistische Feinheiten: ein
Qualitätsindikator darf kein Qualitätsproblem übersehen, er ist folglich hoch-sensitiv eingestellt, ein sog. „Exzellenz-Indikator“
müsste aber hoch-spezifisch eingestellt werden, um denjenigen ohne „Exzellenz-Qualität“ auszuschließen. Dies würde ein
Verkehrung des Indikator-Begriffs in sein Gegenteil bedeuten.
5. These: Es fehlt ein Conceptual Framework (Rahmenkonzept), das politisch die Richtung vorgibt; Qualität
kann politische Entscheidungen nicht ersetzen.
Als maßgebliches Element einer erfolgreichen Weiterentwicklung der Qualitätsthematik fehlt weiterhin ein politisches
"Conceptual Framework" (Rahmenkonzept), das die politisch gewollte Richtung vorgibt (s. Qualität 2030) und den beteiligten
Akteuren als Orientierung für ihr Handeln und ihre Koordinierungsanstrengungen dient (analog Crossing the Quality Chasm
des IOM 2001). Qualität kann eine politisch gewollte strukturelle Weiterentwicklung (in erster Linie Koordination und Integration
der Versorgung) sehr intensiv unterstützen, aber nicht ersetzen. Angesichts des Einsatzes hochkomplexer Instrumente wie P4P
in einem hochkomplexen System, wie es das Gesundheitswesen darstellt (sog. „doppelte Komplexität“), darf dies nicht
verwundern, denn nur so ist es möglich, Fehler bei Einführung und Konzeption sowie die Formulierung nicht erfüllbarer
Erwartungen zu vermeiden. Ein solches Rahmenkonzept muss den Kontext beschreiben, die Auswirkungen antizipieren und
den Hintergrund für Evaluationsmaßnahmen bilden; es sollte dementsprechend folgende Aspekte umfassen:
- Organisation und Autonomie mit Schwerpunkt Expertenorganisation (professional bureaucracy),
- Komplexität des Systems,
- Verhaltensänderung mit Reflexion von Professionalismus und seiner Alternativen,
- ökonomische Grundannahmen insbesondere zu Informationsasymmetrie und Verhaltensökonomie,
- Wechselwirkung mit dem Vergütungssystem, und
- politikwissenschaftliche Konzepte zur Umsetzung.
Ausgehend von „To Err Is Human“ Report 1999 wurden in den USA und in Großbritannien conceptual frameworks für die
weitere Entwicklung des Gesundheitssystemes ausgearbeitet, die Qualität aus systemtheoretischer Sicht im Lichte der
Komplexität des Gesundheitssystems interpretieren. Dieser Ansatz lässt sich auf Ebene der Organisationen sehr gut durch
das Konzept der Expertenorganisation (professional bureaucracy) ergänzen, nicht nur hinsichtlich der Tendenz zur
Selbstorganisation, dem hohen Maß der Autonomie ihrer Mitglieder und der Verdecktheit der gleichwohl vorhandenen internen
Regeln, sondern auch hinsichtlich Innovation und Umgang mit Unsicherheit. Beide Konzepte weisen einerseits eine hohe
Innovationsbereitschaft auf, weichen jedoch andererseits externen Innovationsanreizen aus (“Innovations-Paradoxon”), und –
ncoh entscheidender für den Bereich Qualität und PatientensIcherheit – bieten beide eine weitgehende Toleranz von
Unsicherheit, Spannung und Paradoxie (“intrinsische Unsicherheit”). Diese Toleranz gegenüber Unsicherheit ist einerseits
gewiss von Vorteil, denn sie schützt vor voreiliger Linearität, andererseits kann die Innovationsresistenz z.B. gegenüber
externen Qualitätserwartungen zu schwerwiegenden Defiziten führen (zum Arbeitsbegriff der “komplexen professionellen
Systembürokratie”).
Ein Rahmenkonzept muss aber auch die Ebene der individuellen Verhaltensänderung einbeziehen. In den letzten
Jahrzehnten hat es mehrere Versuche gegeben, mit Modellen der sozialen Wahrnehmung, die über den individuellen Ansatz
der lerntheoretischen Konzepte (z.B. Feedback-Verfahren wie P4P) hinausgehen, Haltungen und Einstellungen zu
beeinflussen und die Veränderungsresistenz des Gesundheitswesens zu überwinden. Gerade in der Diskussion z.B. um
Leitlinien oder die Evidence-based Medicine setzte man auf das Konzept des Professionalismus, das interne Motivation,
Altruismus und Autonomie in den Mittelpunkt stellt. Heute muss man allerdings zusammenfassend festhalten, dass aus diesen
Ansätzen keine tragfähigen Lösungen für die virulenten Probleme entwickelt werden konnten. Diese Ansätze greifen zu kurz,
es ist in der Zukunft eine zusätzliche Einbeziehung von Konzepten des organisatorischen Wandels und des Kontext-
bezogenen Lernens (soziales Marketing) in ein Rahmenkonzept notwendig.
Auf der dritten Ebene sollte ein tragfähiges Rahmenkonzept auch ökonomische Anreize mit organisationstheoretischen
Konzepten und Konzepten der Verhaltensänderung zusammenführen. Als Beispiel sei hier die principal agent-Theorie genannt,
die bei P4P eine große Rolle spielt, und auch aus dem Gebiet der Verhaltensökonomie (behavioural economics) lassen sich
wertvolle Aspekte identifizieren (z.B. Risikoaversion). Zu den vordergründigen, jedoch oft vernachlässigten ökonomischen
Faktoren gehört das Zusammenspiel der Instrumente zur Qualitätsverbesserung mit den vorherrschenden
Vergütungssystemen, denn z.B. P4P ist ja nicht als komplettes Vergütungssystem aller verfügbaren Leistungen denkbar,
sondern immer als „add-on“ zu verstehen. So kann unter P4P der Mengenanreiz verstärkt werden, wenn Ergebnisindikatoren
verwendet werden.
Letztlich müssen – auf der vierten Ebene – die politische Umsetzung und die spezifischen Aufgaben der politischen Ebene
in das Konzept aufgenommen werden. Eine detailierte Regelung „von oben“ ist heute nicht mehr denkbar; moderne Konzepte
wie das der governance sehen explizit die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher und institutioneller Elemente (z.B. informelle
oder privat organisierte Netzwerke) vor, wenngleich die „Politik“ sich der Verantwortung nicht entziehen kann: sie muss
Rahmenbedingungen setzen, die Richtung vorgeben (direction pointing) und frühzeitig unerwünschte Nebenerscheinungen
identifizieren und diese eingrenzen.
* Weitere Regelungen wie die Bewertung von Behandlungsmethoden im Krankenhaus (§137c), Qualitätssicherung bei der Rehabilitation
(§137d), zur Erprobung (§137e), zu den DMPs (§137f, g), zu den Medizinprodukten (§137h), zu den Heil- und Hilfsmittel (§§138, 139) und zum
IQWIG (§139a-d) wurden weitestgehend unverändert belassen und werden hier nicht weiter ausgeführt.
Werner RM (2006), Bradlow ET: Relationship Between Hospital Compare Performance Measures and Mortality Rates. JAMA 296, 2006, 2694-
2702

20

Seite


20

Seite




